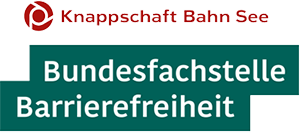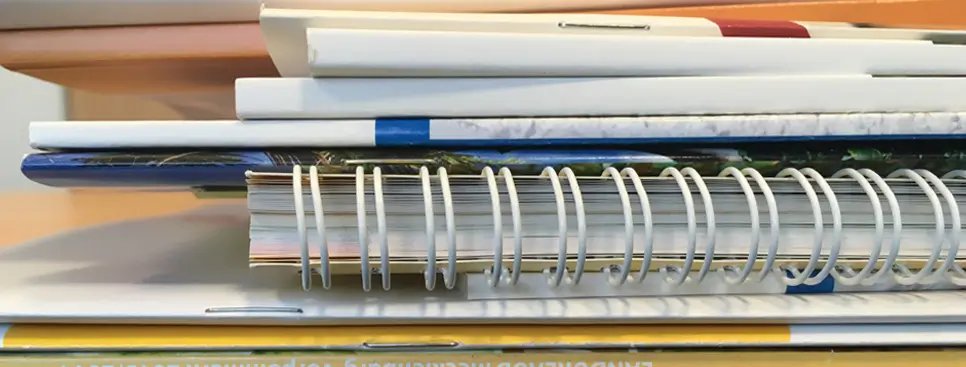Neuntes Netzwerktreffen zur digitalen Barrierefreiheit
Datum 07.10.2025
Austausch in großer Runde: Das neunte Netzwerktreffen digitale Barrierefreiheit, zu dem die Bundesfachstelle Bundesbehörden eingeladen hatte, fand am 25. September als Online-Treffen statt. 80 Mitarbeitende von Bundesbehörden nahmen an der Veranstaltung teil. Die Schwerpunktthemen waren diesmal Kompetenzzentren Barrierefreiheit in Behörden sowie die Prüfung von digitalen Anwendungen für neurodivergente Personen.
Nach der Begrüßung durch Dorothee Wulf berichteten die Kolleginnen und Kollegen kurz über Neuigkeiten aus der Bundesfachstelle. Anschließend stellten zwei Bundesministerien ihre Kompetenzstelle Barrierefreiheit vor.
Kompetenzstellen Barrierefreiheit in Bundesbehörden – Beispiel 1: BMLEH
Als Erste berichtete Sandra Gärtner, die im Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) die Kompetenzstelle für Barrierefreiheit inne hat. Diese wurde im Juli 2023 gegründet. In ihrem Vortrag erzählte Frau Gärtner von ihren Aufgaben, den Strukturen und der Einbindung der Stelle innerhalb des Ministeriums. Die Kompetenzstelle ist für die Themen digitale und bauliche Barrierefreiheit zuständig. Sie ist organisatorisch beim Inklusionsbeauftragten des BMLEH angesiedelt.
Ihre Aufgaben bündelte Frau Gärtner unter den Stichworten „Kommunikation, Koordination und Kompetenzaufbau“. Die Kommunikation innerhalb des Ministeriums sei ein wesentlicher Faktor. Einerseits ginge es um Aufklärung über das Thema digitale Barrierefreiheit, andererseits um das Verstehen von beispielsweise der korrekten Nutzung von Word, die für eine barrierefreie Datei wesentlich ist. Word-Schulungen seien daher ein Baustein für die Verbreitung des Wissens innerhalb der Behörde.
Für den Austausch im Ministerium wurde eine Projektgruppe gegründet, in der Personen aus den verschiedenen Bereichen wie IT, Öffentlichkeitsarbeit und Organisation vertreten sind. Diese Gruppe trifft sich regelmäßig und tauscht sich über Projekte aus, die gerade in den jeweiligen Referaten umgesetzt werden und wo ggf. auch Zuarbeit eines anderen Referates benötigt wird. Zudem wirken die Mitglieder als „Multiplikatoren“ in ihre jeweiligen Fachbereiche hinein. Mit dieser Projektgruppe werde die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit verbessert, die auch für die Sensibilisierung auf das Thema Barrierefreiheit hilfreich sei, bilanzierte Frau Gärtner.
Wenn es neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, erhalten diese eine E-Mail mit dem Angebot einer Schulung für barrierefreie Dokumente.
Kompetenzstellen Barrierefreiheit in Bundesbehörden – Beispiel 2: Auswärtiges Amt
Als zweites Beispiel berichteten Stephanie Weidner und Lydia Sasnovskis über die Kompetenzstelle für digitale Barrierefreiheit im Auswärtigen Amt. Frau Weidner erklärte, dass die Kompetenzstelle organisatorisch in der Zentralabteilung (Unterabteilung für Digitalisierung) verortet ist. Die Kompetenzstelle sei Teil des Grundsatzreferats Digitalisierung und wurde Ende 2022 gegründet. Derzeit arbeiten dort zwei Kolleginnen anteilig zum Thema digitale Barrierefreiheit. Der Leitung der Kompetenzstelle (derzeit vakant, Neubesetzung in Kürze vorgesehen) obliegt zudem die Planung, Steuerung und konzeptionelle Betreuung des Themas.
Die Kompetenzstelle treibt die digitale Barrierefreiheit im Haus voran: Sie hat im Intranet des Auswärtigen Amtes ein Infoportal zum Thema digitale Barrierefreiheit erstellt, das über die Rechtsgrundlagen informiert und Handreichungen zur Verfügung stellt. Darüber hinaus hilft sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus bei der Erstellung barrierefreier Dokumente. Zudem erstellt die Kompetenzstelle Berichte ( z. B. an die BFIT-Bund), unterstützt bei der Beantwortung parlamentarischer Anfragen sowie von Presseanfragen und bereitet Sachstände sowie Gesprächsunterlagen vor.
Das Thema digitale Barrierefreiheit ist im Auswärtigen Amt dezentral organisiert. Die Kompetenzstelle arbeitet mit verschiedenen Arbeitseinheiten im Haus zusammen, z. B. dem Pressereferat, der Fortbildung, der In- und Auslandskommunikation, dem Personalrat und besonders eng mit der Schwerbehindertenvertretung. Zudem unterstützt sie das IT-Projektmanagement bei der Umsetzung digitaler Barrierefreiheit in den vielfältigen IT-Projekten. Dabei betonte Frau Weidner, wie wichtig es sei, die digitale Barrierefreiheit bei diesen Projekten von Anfang an mit zu berücksichtigen.
Anschließend ergänzte Lydia Sasnovskis, Schwerbehindertenvertretung (SBV) im Auswärtigen Amt. Sie unterstrich, wie wesentlich die enge Kooperation und Vernetzung zwischen SBV und der Kompetenzstelle sei. Außerdem berichtete sie über eine vor kurzem durchgeführte erste Schulung, die sich speziell an Screenreader nutzende Beschäftigte wandte, um diese gezielt im Hinblick auf die im Auswärtigen Amt verwendeten Fachanwendungen zu schulen. Aus Sicht der Beteiligten war diese Fortbildungsmaßnahme sehr gewinnbringend. Ihre regelmäßige Fortführung wäre daher wünschenswert, so Sasnovskis.
Vortrag: Prüfung für neurodivergente Personen – DRV Bund
Das zweite Schwerpunktthema wurde vom Team IT-Barrierefreiheit der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund) eingebracht. In ihrem Vortrag „Digitale Barrierefreiheit – Prüfung für neurodivergente Personen“ stellten Sarah Edding und Philipp Becker diese Personengruppe vor und ihre Bedürfnisse, was die digitale Barrierefreiheit betrifft.
Sarah Edding erläuterte zunächst den Begriff „Neurodivergenz“ und nannte die verschiedenen Gruppen, die zu diesem Kreis zählen. Dazu gehören Menschen aus dem autistischen Spektrum, Menschen mit ADHS, mit Dyslexie, Legasthenie oder Dyskalkulie, mit Dyspraxie oder auch mit Tourette-Syndrom. Tatsächlich sei diese Personengruppe relativ groß, so hätte allein in Deutschland über 5 Prozent der Bevölkerung ADHS.
Die Bedürfnisse dieser Gruppe hinsichtlich digitaler Barrierefreiheit sei inzwischen recht gut erfasst, sagte Frau Edding. Einerseits gäbe es in der EN 301 549 entsprechende Vorgaben. In der Norm seien kognitive Einschränkungen (LC – limited cognition) und neurologische Einschränkungen (PST – photosensitive seizure triggers) enthalten.
Andererseits gäbe es auch aktuellere Forschung, so beispielsweise eine Studie, die von der Europäischen Kommission beauftragt und 2022 veröffentlicht wurde. Der Titel lautet „Pilot Project Study: Inclusive Web-Accessibility for Persons with Cognitive Disabilities“ (abrufbar unter https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-publishes-study-inclusive-web-accessibility-persons-cognitive-disabilities).
Als nächstes erklärte Frau Edding, welche Barrieren es für neurodivergente Personen im digitalen Bereich gibt. So können beispielsweise durch nicht abschaltbare Videos oder Animationen Ablenkung, Reizüberflutung und Orientierungslosigkeit entstehen. Auch Werbung stört daher häufig.
Ein weiteres Problem bezieht sich auf zu komplexe Inhalte, also zum Beispiel umständliche Formulare und Authentifizierungsprozesse oder unnötig komplizierte Sicherheitsanforderungen.
Andere Barrieren für neurodivergente Menschen können Zeitbegrenzungen sein (wie automatischer Log-out nach einer bestimmten Zeit) oder fehlende Untertitel oder Transkripte bei Videos. Auch weitere Barrieren führte sie auf.
Im Anschluss berichtete Philipp Becker, welche relevanten Prüfkriterien es für diese Personengruppe gibt. Zeilenlängen und Textabstände sind ein Kriterium – denn zu lange Zeilen und kleine, eng gesetzte Texte sind schlecht lesbar für die Gruppe. Beim Text sollten Abstände, Vergrößerung und ggf. Schriftart anpassbar sein. Ebenso sollten Schriftgrafiken vergrößerbar sein.
Ein weiteres für die Zielgruppe wichtiges Prüfkriterium ist, dass man Inhalte pausieren, stoppen oder ausblenden kann. Dies gilt besonders für ablenkende Inhalte, z. B. Videos, Werbung, Laufschrift.
Herr Becker erklärte weiter, was bei Formularfeldern wesentlich ist. Hier muss der Eingabezweck bestimmt werden, eine Fehlerkennzeichnung gegeben sein und ein Vorschlag bei Fehlermeldung gemacht werden. Dadurch würden auch Fehler bei der Eingabe vermieden.
Bei der inhaltlichen Gestaltung von Texten auf Websites sei es wichtig, dass Inhalte strukturiert werden. Überschriften und Zwischenüberschriften sollten verwendet werden und es soll möglich sein, mit Sprungmarken Textabschnitte zu überspringen. Auch ein Seitentitel sollte vergeben sein.
Bezüglich der Kommunikation mit dem Herausgeber der Website: Die Kommunikation und ggf. der Support sollten auf mehreren Kanälen möglich sein. Manche Menschen mit Autismus haben Probleme, am Telefon zu sprechen.
Ein weiterer Punkt (der an dieser Stelle nicht vollständig wiedergegebenen Liste) ist eine konsistente Navigation, die auch gut beschriftet ist.
Netzwerk digitale Barrierefreiheit
Seit Sommer 2022 veranstaltet die Bundesfachstelle Barrierefreiheit mindestens zweimal jährlich Netzwerktreffen zur digitalen Barrierefreiheit für Behörden des Bundes. Ziel ist der Austausch und die Vernetzung für die Umsetzerinnen und Umsetzer von digitaler Barrierefreiheit in den Behörden. Aktuell sind bereits über 220 Mitarbeitende von Bundesbehörden Teil des Netzwerks.
Sie möchten auch teilnehmen?
Wenn Sie in einer Bundesbehörde zum Thema digitale Barrierefreiheit arbeiten und Interesse haben, ebenfalls Mitglied im Netzwerk zu werden und an den Treffen teilzunehmen, melden Sie sich bitte bei der Bundesfachstelle:
bundesfachstelle-barrierefreiheit@kbs.de
.
Weitere Informationen zum Netzwerk finden Sie hier: Netzwerk digitale Barrierefreiheit
Das nächste Netzwerktreffen wird am 30. Oktober in Nürnberg stattfinden und wird von den Kolleginnen und Kollegen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge organisiert.